.
Am Anfang eines jeden Bootbauprojektes stellen sich etliche Fragen, deren
Beantwortung von großem Einfluß auf die spätere Gestalt des fertigen Bootes
ist. Die erste ist die nach dem Verwendungszweck, aus dem sich eine Reihe von
Anforderungen an die Eigenschaften eines Bootes ergeben. Je nach Zweck des
Bootes haben gewisse Forderungen Vorrang gegenüber anderen. So wird zum Beispiel
bei einem Rennboot die Geschwindigkeit wichtiger sein als ein großzügiges
Platzangebot. Meist zieht jedoch die besondere Berücksichtigung einer Eigenschaft
Kompromisse in bezug auf andere Eigenschaften nach sich. Wird beispielsweise
ein Rumpf eher lang und schmal ausgelegt, verringert sich sein Formwiderstand
und die erreichbare Rumpfgeschwindigkeit wird erhöht, gleichzeitig wird aber
auch die Fläche im Vergleich zu einem eher völligen, also kompakten Rumpf erhöht
und der Reibungswiderstand steigt. Wenn nun die Geschwindigkeit im Vordergrund
steht, wird man zu einer Bauweise mit möglichst geringem Formwiderstand tendieren,
da dieser mit der Geschwindigkeit im Quadrat ansteigt. Hier zeigt sich bereits,
daß das optimale Boot eine ziemlich relative Angelegenheit ist. Nun ergeben sich
aus Rumpfform und Rumpfgröße mögliche Bauweisen und verwendbare Materialien.
Die Bauweise eines Bootes steht in engem Zusammenhang mit dem gewählten oder zur
Verfügung stehenden Material und den Möglichkeiten, es zu bearbeiten. Die
ältesten sind Holz und Tierhäute. Holz wird heute sowohl in seiner ursprünglichen
Form als auch aufbereitet zu Holzwerkstoffen wie z.B. Sperrholzplatten verarbeitet.
Es eignet sich vor allem für Boote, bei denen in geringes Gewicht gefordert ist,
da es aufgrund seiner Struktur als ein "Mikrofachwerk" anzusehen ist, und
Fachwerkkonstruktionen zeichnen sich ja nun mal durch hohe Festigkeit im
Verhältnis zum Gewicht aus. In den meisten Fällen lassen sich Rümpfe aus Holz
ohne aufwendige Formen oder Pressen herstellen, was die Herstellung von Einzelbauten
begünstigt, da sich Holz mit vergleichsweise einfachen Mitteln in nahezu jede Form
bringen lässt, besonders in Verbindung mit Harzen, wie
Epoxid. Kleinere Rümpfe lassen sich aus
Holz als nahezu selbsttragende Konstruktionen mit nur wenig Versteifungen wie z.B.
Spanten realisieren, wenn sie aus miteinander verklebten Sperrholzplatten oder
aus in wechselnden Richtungen übereinandergeklebten dünnen Holzstreifen (Furniere)
gebaut werden. Da Holz porös ist und daher zur
Aufnahme von Wasser und schließlich zum Faulen neigt ist ein gewisser Aufwand
nötig, dies zu verhindern. Die heute zur Verfügung stehenden Harze und
Beschichtungssysteme tun dies bei sachgerechter Anwendung, so daß wir Holzboote
herstellen können, die nicht wesentlich empfindlicher oder pflegeintensiver als
solche aus Stahl oder Kunststoff sind, es sei denn, man wählt aus ästhetischen
Gründen eine Klarlackierung. Hier kann, außen angewandt, der beste Klarlack
nicht gegen die zerstörende Wirkung der UV-Strahlung ankommen, es ist wie mit
der menschlichen Haut: Jede Sonneneinwirkung hinterlässt langfristig
Spuren, ein Lichtschutzfaktor in der Beschichtung kann dies verzögern, aber nicht
verhindern, einen verlässlichen, dauerhaften Schutz bieten leider nur deckende, also
lichtundurchlässige Anstriche. In diesem Fall hat Schönheit einfach ihren Preis.
Der Werkstoff Stahl bietet sich bei Booten ab einer gewissen Größe an, bei sehr
kleinen Fahrzeugen müßte man entweder ein recht hohes Gewicht oder eine sehr
dünnwandige Aussenhaut in Kauf nehmen, die eine sehr filigrane Aussteifung ähnlich
wie im Flugzeugbau erfordern würde. Da bei größeren Fahrzeugen die Hebel und damit
auch die Spannungen im Material größer werden, kommt Stahl mit seiner hohen
Zugfestigkeit den Anforderungen sehr entgegen. Im Gegensatz zu Holz ist Stahl
in vergleichsweise großen Abmessungen erhältlich, was z.b. bei der Verarbeitung
von Plattenmaterial zu einer geringeren Zahl von Nähten und somit von Arbeitsaufwand
führt. Während der Versuch, Sperrholzplatten in eine in mehrere Richtungen gekrümmte
Form zu bringen, ab einer etwas stärkeren Krümmung zu Bruch führt, ist dies mit
Stahlplatten möglich, da sie gestaucht und gestreckt werden können, was allerdings
ein erhebliches Maß an Arbeitsaufwand bedeutet. Alternativ zu Stahl kann auch
Aluminium eingesetzt werden, wobei das niedrigere Gewicht sich nicht in jedem
Fall voll auswirken kann, da aufgrund der niedrigeren Festigkeit oft stärker
dimensioniert werden muß.
Faserverstärkte Kunststoffe haben ein weites Spektrum, was das Verhältnis von
Festigkeit und Gewicht angeht, hierzu zählen sowohl in Formen gespritzte Gemische
aus Polyesterharzen und gehäckselten Glasfasern als auch sorgfältig von Hand laminierte
High-Tech-Fasern wie Kevlar. Letztere finden auch Anwendung in der Holz-Epoxid-Verarbeitung.
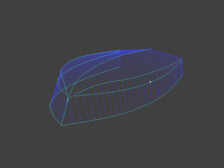

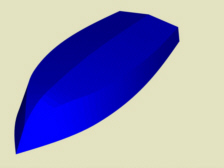
Ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium bei der Auswahl von Bauart und Material
sind natürlich Material- und vor allem Arbeitsaufwand. Hier ist aus naheliegenden
Gründen die Knickspant- der Rundspantbauweise überlegen. Ein Knickspantrumpf besteht
zunächst aus je zwei Boden- und Seitenplatten und einer Spiegelplatte. Setzt man
nun voraus, daß die Außenflächen des Rumpfes eine zusammenhängende Flächenabwicklung
zulassen, bedeutet dies, daß der Rumpf abgesehen von inneren Versteifungen aus nur
fünf einzelnen Plattenstücken zusammengefügt werden kann. Nimmt man dazu noch an,
daß das "Schnittmuster" vor Baubeginn feststeht und die Plattenstücke von einem
Automaten in ihre endgültige Form geschnitten werden können, ergibt sich ein
erheblich reduzierter Arbeitsaufwand. Zu diesem Zweck habe ich ein System von
Algorithmen entwickelt, die eine exakte mathematische Darstellung eines aus mehreren
gekrümmten und abwickelbaren Flächen bestehenden Körpers erzeugen können. In der
praktischen Anwendung laufen diese Algorithmen als ein LISP-Programm in einer
handelsüblichen CAD-Anwendung. Über die Eingabe diverser Parameter können die
Eigenschaften des erzeugten Körpers bzw. Bootes wie Krümmung der Linien, Winkel
der Platten zueinander und natürlich die Abmessungen beeinflusst werden. Das
Ergebnis ist ein dreidimensionales Modell des Rumpfes sowie eine Flächenabwicklung.
Gleichzeitig werden Verdrängung, Gewicht und deren Schwerpunkte berechnet. Im
dreidimensionalen Modell können dann weitere Bauteile von Kiel und Spanten bis
hin zur Inneneinrichtung eingezeichnet werden, die anschliessend wie die
Flächenabwicklungen der Außenhaut von Automaten anhand der erzeugten Datei
zugeschnitten werden. Dieses Verfahren bietet folgende Vorteile:
1. Es können in kurzer Zeit eine Reihe von Entwürfen gemacht und fortlaufend
optimiert werden, zeitraubendes Zeichnen und Berechnen von Hand entfällt.
2. Durch Verfahren wie Rendering und Raytracing lassen sich realitätsnahe
räumliche Abbildungen des Bootes erzeugen.
3. Durch die Verbindung von CAD (Computer Aided Design) und CAM (Computer Aided Manufacturing)
ist die Herstellung sowohl kostengünstiger als auch präziser.
4. Da das angewandte Programm konsequent abwickelbare Flächen erzeugt, was mit
herkömmlichen Methoden so gut wie nicht zu erreichen ist, wird gewährleistet, daß
sich die vorgefertigten Teile zu einem Boot zusammenfügen lassen.
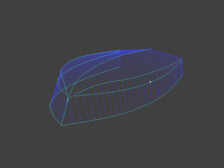

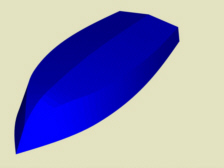 Ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium bei der Auswahl von Bauart und Material
sind natürlich Material- und vor allem Arbeitsaufwand. Hier ist aus naheliegenden
Gründen die Knickspant- der Rundspantbauweise überlegen. Ein Knickspantrumpf besteht
zunächst aus je zwei Boden- und Seitenplatten und einer Spiegelplatte. Setzt man
nun voraus, daß die Außenflächen des Rumpfes eine zusammenhängende Flächenabwicklung
zulassen, bedeutet dies, daß der Rumpf abgesehen von inneren Versteifungen aus nur
fünf einzelnen Plattenstücken zusammengefügt werden kann. Nimmt man dazu noch an,
daß das "Schnittmuster" vor Baubeginn feststeht und die Plattenstücke von einem
Automaten in ihre endgültige Form geschnitten werden können, ergibt sich ein
erheblich reduzierter Arbeitsaufwand. Zu diesem Zweck habe ich ein System von
Algorithmen entwickelt, die eine exakte mathematische Darstellung eines aus mehreren
gekrümmten und abwickelbaren Flächen bestehenden Körpers erzeugen können. In der
praktischen Anwendung laufen diese Algorithmen als ein LISP-Programm in einer
handelsüblichen CAD-Anwendung. Über die Eingabe diverser Parameter können die
Eigenschaften des erzeugten Körpers bzw. Bootes wie Krümmung der Linien, Winkel
der Platten zueinander und natürlich die Abmessungen beeinflusst werden. Das
Ergebnis ist ein dreidimensionales Modell des Rumpfes sowie eine Flächenabwicklung.
Gleichzeitig werden Verdrängung, Gewicht und deren Schwerpunkte berechnet. Im
dreidimensionalen Modell können dann weitere Bauteile von Kiel und Spanten bis
hin zur Inneneinrichtung eingezeichnet werden, die anschliessend wie die
Flächenabwicklungen der Außenhaut von Automaten anhand der erzeugten Datei
zugeschnitten werden. Dieses Verfahren bietet folgende Vorteile:
1. Es können in kurzer Zeit eine Reihe von Entwürfen gemacht und fortlaufend
optimiert werden, zeitraubendes Zeichnen und Berechnen von Hand entfällt.
2. Durch Verfahren wie Rendering und Raytracing lassen sich realitätsnahe
räumliche Abbildungen des Bootes erzeugen.
3. Durch die Verbindung von CAD (Computer Aided Design) und CAM (Computer Aided Manufacturing)
ist die Herstellung sowohl kostengünstiger als auch präziser.
4. Da das angewandte Programm konsequent abwickelbare Flächen erzeugt, was mit
herkömmlichen Methoden so gut wie nicht zu erreichen ist, wird gewährleistet, daß
sich die vorgefertigten Teile zu einem Boot zusammenfügen lassen.
Ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium bei der Auswahl von Bauart und Material
sind natürlich Material- und vor allem Arbeitsaufwand. Hier ist aus naheliegenden
Gründen die Knickspant- der Rundspantbauweise überlegen. Ein Knickspantrumpf besteht
zunächst aus je zwei Boden- und Seitenplatten und einer Spiegelplatte. Setzt man
nun voraus, daß die Außenflächen des Rumpfes eine zusammenhängende Flächenabwicklung
zulassen, bedeutet dies, daß der Rumpf abgesehen von inneren Versteifungen aus nur
fünf einzelnen Plattenstücken zusammengefügt werden kann. Nimmt man dazu noch an,
daß das "Schnittmuster" vor Baubeginn feststeht und die Plattenstücke von einem
Automaten in ihre endgültige Form geschnitten werden können, ergibt sich ein
erheblich reduzierter Arbeitsaufwand. Zu diesem Zweck habe ich ein System von
Algorithmen entwickelt, die eine exakte mathematische Darstellung eines aus mehreren
gekrümmten und abwickelbaren Flächen bestehenden Körpers erzeugen können. In der
praktischen Anwendung laufen diese Algorithmen als ein LISP-Programm in einer
handelsüblichen CAD-Anwendung. Über die Eingabe diverser Parameter können die
Eigenschaften des erzeugten Körpers bzw. Bootes wie Krümmung der Linien, Winkel
der Platten zueinander und natürlich die Abmessungen beeinflusst werden. Das
Ergebnis ist ein dreidimensionales Modell des Rumpfes sowie eine Flächenabwicklung.
Gleichzeitig werden Verdrängung, Gewicht und deren Schwerpunkte berechnet. Im
dreidimensionalen Modell können dann weitere Bauteile von Kiel und Spanten bis
hin zur Inneneinrichtung eingezeichnet werden, die anschliessend wie die
Flächenabwicklungen der Außenhaut von Automaten anhand der erzeugten Datei
zugeschnitten werden. Dieses Verfahren bietet folgende Vorteile:
1. Es können in kurzer Zeit eine Reihe von Entwürfen gemacht und fortlaufend
optimiert werden, zeitraubendes Zeichnen und Berechnen von Hand entfällt.
2. Durch Verfahren wie Rendering und Raytracing lassen sich realitätsnahe
räumliche Abbildungen des Bootes erzeugen.
3. Durch die Verbindung von CAD (Computer Aided Design) und CAM (Computer Aided Manufacturing)
ist die Herstellung sowohl kostengünstiger als auch präziser.
4. Da das angewandte Programm konsequent abwickelbare Flächen erzeugt, was mit
herkömmlichen Methoden so gut wie nicht zu erreichen ist, wird gewährleistet, daß
sich die vorgefertigten Teile zu einem Boot zusammenfügen lassen.